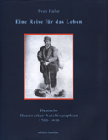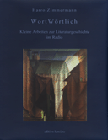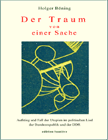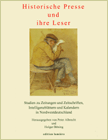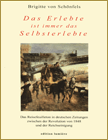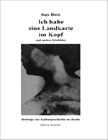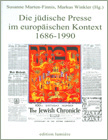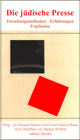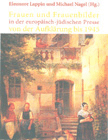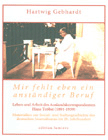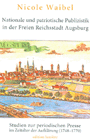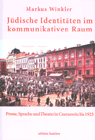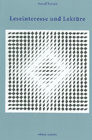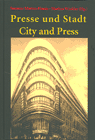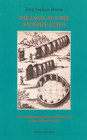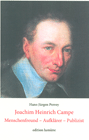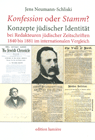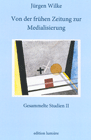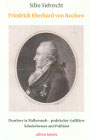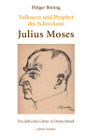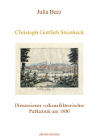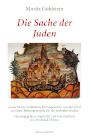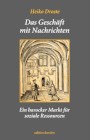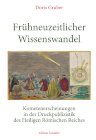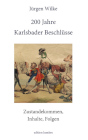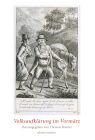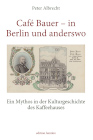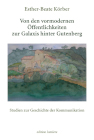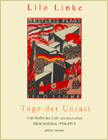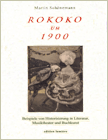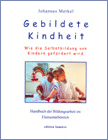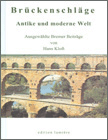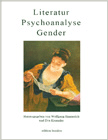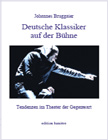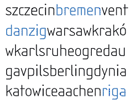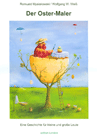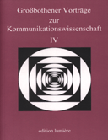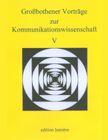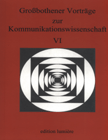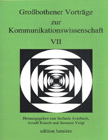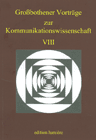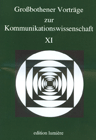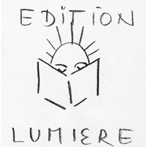Verlagsprogramm
Presse und Geschichte – Neue Beiträge
Herausgegeben von Astrid Blome, Holger Böning und Michael Nagel.
Die Entwicklung der Moderne ist ohne Druckerpresse nicht vorstellbar. Ihre Produkte sind Gegenstand dieser
Reihe, wobei die periodischen Schriften – Kalender, Zeitung, Zeitschrift, Intelligenzblatt – im Mittelpunkt
stehen. Doch auch andere Schriften und ihre Wirkungen sind nicht ausgeschlossen, Reisebeschreibungen etwa, die
der Weltaneignung dienten, oder Autobiographien, die zur Selbstverständigung des Lesepublikums beitrugen. Ziel
ist es, Bedeutung und Reichtum der publizistischen und literarischen Produktion zu erfassen, wie sie maßgeblich
die Entwicklung der modernen Gesellschaft geprägt hat und bis heute unseren Alltag bestimmt.

|
 |
 |
|
Band 1 Vergriffen
Astrid Blome
Zeitung Zeitschrift Intelligenzblatt und Kalender
|
Band 2 Vergriffen
Arnulf Kutsch,
Johannes Weber
350 Jahre Tageszeitung
(siehe Band
51)
|
Band 3 Vergriffen
Astrid Blome,
Volker Depkat
Von der "Civilisirung" Rußlands und dem "Aufblühen" Nordamerikas im 18. Jahrhundert
|
 |
 |
 |
|
Band 4 Vergriffen
Wynfrid Kriegleder,
Andrea Seidler,
Jozef Tancer
Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pressburg
|
Band 5
Holger Böning
Welteroberung durch ein neues Publikum. Die Deutsche Presse und der Weg zur Aufklärung
|
Band 6 Vergriffen
Holger Böning
Periodische Presse. Kommunikation und Aufklärung
|
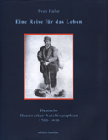 |
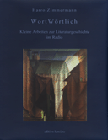 |
 |
|
Band 7
Sven Halse
Eine Reise für das Leben Deutsche Handwerker- Autobiographien 1700-1910
|
Band 8 Vergriffen
Harro Zimmermann
WortWörtlich.Kleine Arbeiten zur Literaturgeschichte im Radio
|
Band 9
Aïssatou Bouba
"Kinder des Augenblickes". Die Ethnien Deutsch-Nordkameruns in deutschsprachigen
Reiseberichten (1850-1919)
|
 |

|
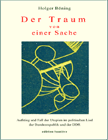 |
|
Band 10
Michael Nagel
Reisen – Erkunden – Erzählen Bilder aus der europäischen Ethnologie und Literatur
|
Band 11
Wynfrid Kriegleder und Andrea Seidler
Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland
|
Band 12
Holger Böning
Der Traum von einer Sache. Aufstieg und Fall der Utopien im politischen Lied der
Bundesrepublik und der DDR.
|
 |
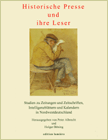 |
 |
|
Band 13
Holger Böning, Hartwig Gebhardt, Michael Nagel und Johannes Weber
Deutsche Presseforschung. Geschichte, Projekte und Perspektiven eines
Forschungsinstituts der Universität Bremen.
|
Band 14 Vergriffen
Peter Albrecht und Holger Böning
Historische Presse und ihre Leser. Studien zu Zeitungen und Zeitschriften,
Intelligenzblättern und Kalendern in Norddeutschland.
|
Band 15 Vergriffen
Karl Heinz Kremer
Johann von den Birghden (1582-1645). Kaiserlicher und königlich-schwedischer
Postmeister zu Frankfurt am Main.
|
 |
 |
 |
|
Band 16
Holger Böning, Hans Wolf Jäger, Andrzej Katny und Marian Szczodrowski
Danzig und der Ostseeraum. Sprache, Literatur, Publizistik.
|
Band 17
Thomas Habel
"Gelehrte Journale" der Aufklärung. Zur Entstehung, Entwicklung und Erschließung
deutschsprachiger Rezensionszeitschriften des 18. Jahrhunderts.
|
Band 18
Manuela Schulz
Zeitungslektüre und Landarbeiterschaft.
|
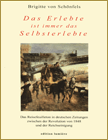 |
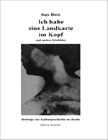 |
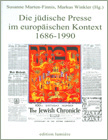 |
|
Band 19
Brigitte von Schönfels
Das Erlebte ist immer das Selbsterlebte. Das Reisefeuilleton in deutschen Zeitungen
zwischen der Revolution von 1848 und der Reichseinigung.
|
Band 20
Inge Buck
Ich habe eine Landkarte im Kopf. Und andere Hörbilder. Beiträge zur Kulturgeschichte
im Radio.
|
Band 21
Susanne Marten-Finnis und Markus Winkler
Die jüdische Presse im europäischen Kontext 1686-1990.
|
 |
 |
 |
|
Band 22 Vergriffen
Lutz Voigtländer
Krieg für den "gemeinen Mann". Der mit einem Sächsischen Bauer von jetzigem Kriege
redende Französische Soldat.
|
Band 23
Martin Welke und Jürgen Wilke
400 Jahre Zeitung. Die Geschichte der Tagespresse im internationalen Kontext.
|
Band 24
Wynfried Kriegleder/ Andrea Seidler/ Jozef Tancer
Deutsche Sprache, Kultur und Presse in der Zips.
|
 |
 |
 |
|
Band 25
Holger Böning und Werner Ort
Das Goldmacherdorf oder wie man reich wird. Ein historisches Lesebuch von Heinrich
Zschokke.
|
Band 26
Imanuel Geiss
Nation und Nationalismen. Versuche über ein Weltproblem. 1962-2006.
|
Band 27
Holger Böning, Hanno Schmitt und Reinhart Siegert
Volksaufklärung. Eine praktische Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts.
|
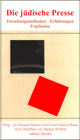 |
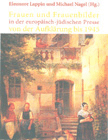 |
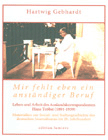 |
|
Band 28
Susanne Marten-Finnis und Markus Bauer
Die jüdische Presse – Forschungsmethoden – Erfahrungen – Ergebnisse.
|
Band 29
Eleonore Lappin und Michael Nagel
Frauen und Frauenbilder in der europäisch-jüdischen Presse von der Aufklärung bis
1945.
|
Band 30
Hartwig Gebhardt
Mir fehlt eben ein anständiger Beruf. Leben und Arbeit des Auslandskorrespondenten
Hans Tröbst (1891-1939). Materialien zur Sozial- und Kulturgeschichte des deutschen Journalismus im 20.
Jahrhundert.
|
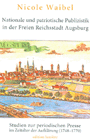 |
 |
 |
|
Band 31
Nicole Waibel
Nationale und patriotische Publizistik in der Freien Reichsstadt Augsburg. Studien zur
periodischen Presse im Zeitalter der Aufklärung.
(1748-1770).
|
Band 32
Jozef Tancer
Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18.
Jahrhunderts.
|
Band 33
Uta Egenhoff
Berufsschriftstellertum und Journalismus in der Frühen Neuzeit. Eberhard Werner
Happels Relationes Curiosae im Medienverbund des 17. Jahrhunderts.
|
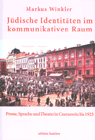 |
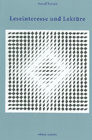 |
 |
|
Band 34 Vergriffen
Markus Winkler
Jüdische Identitäten im kommunikativen Raum. Presse, Sprache und Theater in Czernowitz
bis 1923.
|
Band 35
Arnulf Kutsch
Leseinteresse und Lektüre. Die Anfänge der empirischen Le-
se(r)forschung in
Deutschland und den USA am Beginn des 20. Jahrhunderts.
|
Band 36
Astrid Blome und Holger Böning
Presse und Geschichte. Leistungen und Perspektiven der historischen Presseforschung.
|
 |
 |
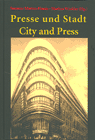 |
|
Band 37
Eleonore Lappin und Michael Nagel
Deutsch–jüdische Presse und jüdische Geschichte: Dokumente, Darstellungen,
Wechselbeziehungen. Band 1
|
Band 38
Eleonore Lappin und Michael Nagel
Deutsch–jüdische Presse und jüdische Geschichte: Dokumente, Darstellungen,
Wechselbeziehungen. Band 2
|
Band 39
Susanne Marten-Finnis und Markus Winkler
Presse und Stadt. City and Press.
|
 |
 |
 |
|
Band 40
Teresa Tschui
Wie solche Figur zeiget. Der schweizerische Volkskalender als Bildmedium vom 17. bis
zum 19. Jahrhundert.
|
Band 41
Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler und Jozef Tancer
Deutsche Sprache und Kultur
Presse – Literatur – Geschichte
in Siebenbürgen
|
Band 42
Tilman T. R. Rau
Das Commercium Litterarium. Die erste medizinische Wochenschrift in Deutschland und
die Anfänge des medizinischen Journalismus.
|
 |
 |
 |
|
Band 43
Holger Dainat
Heinrich Zschokke. Deutscher Aufklärer – Schweizer Revolutionär Publizist –
Volkspädagoge – Schriftsteller – Politiker.
|
Band 44
Irmtraud Ubbens
Sein Kampf für Recht, Freiheit und Anstand war notorisch. Moritz Goldstein – "Inquit"
|
Band 45
Jürgen Wilke
Massenmedien und Journalismus in Geschichte und Gegenwart. Gesammelte Studien.
|
 |
 |
 |
|
Band 46
Esther-Beate Körber
Zeitungsextrakte. Aufgaben und Geschichte einer funktionellen Gruppe frühneuzeitlicher
Publizistik.
|
Band 47
Esther-Beate Körber
Biobibliographie der Zeitungsextrakte. Kommentierte Bibliographie der periodisch
erschienenen Zeitungsextrakte sowie biographische Hinweise zu Herausgebern, Verlegern, Druckern und
Beiträgern
|
Band 48 Vergriffen
Stefanie Averbeck-Lietz, Petra Klein und Michael Meyen
Historische und systematische Kommunikationswissenschaft. Festschrift für Arnulf
Kutsch.
|
 |
 |
 |
|
Band 49
Werner Greiling und Franziska Schulz
Vom Autor zum Publikum. Kommunikation und Ideenzirkulation um 1800.
|
Band 50 Vergriffen
Holger Böning
Der Musiker und Komponist Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Studie zu den
Anfängen der Moralischen Wochenschriften und der deutschen Musikpublizistik. (siehe Band 78)
|
Band 51 Vergriffen
Arnulf Kutsch/ Johannes Weber
350 Jahre Tageszeitung. Forschungen und Dokumente. 2. durchgesehene Auflage.
|
 |
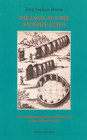 |
 |
|
Band 52
Maria Rózsa
Studien zur deutschsprachigen Presse in Mittel- und Ostmitteleuropa
|
Band 53
Jörg Jochen Berns
DIE JAGD AUF DIE NYMPHE ECHO. Zur Technisierung der Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit.
|
Band 54
Volker Bauer und Holger Böning
Die Entstehung des Zeitungs-wesens im 17. Jahrhundert: Ein neues Medium und seine
Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit
|
 |
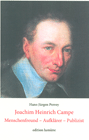 |
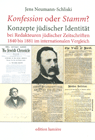 |
|
Band 55
Julius Moses
Die Lösung der Judenfrage: Eine Rundfrage von Julius Moses im Jahre 1907
|
Band 56
Hans-Jürgen Perrey
Joachim Heinrich Campe (1746 – 1818). Menschenfreund – Aufklärer – Publizist.
|
Band 57
Jens Neumann-Schliski
"Konfession" oder "Stamm"?. Konzepte jüdischer Identität bei Redakteuren jüdischer
Zeitschriften 1840 bis 1881 im internationalen Vergleich.
|
 |
 |
 |
|
Band 58
Hanno Schmitt, Holger Böning, Werner Greiling und
Reinhart Siegert
Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der
Aufklärung.
|
Band 59
Alexander Hesse
"Schule und Elternhaus"
(1924–1938).Porträt einer illustrierten Ratgeber-,
Unterhaltungs- und Versicherungszeitschrift.
|
Band 60
Norbert D. Wernicke
" kurz, was sich in den Kalender schikt.". Literarische Texte in Schweizer
Volkskalendern von 1508 bis 1848.
|
 |
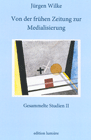 |
 |
|
Band 61
Ingrid Löwer
Die 68er im Spiegel ihrer Kinder. Eine vergleichende Untersuchung zu
familienkritischen Prosatexten der jüngeren Autorengeneration.
|
Band 62
Jürgen Wilke
Von der frühen Zeitung zur Medialisierung.Gesammelte Studien II.
|
Band 63
Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer
Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest
|
 |
 |
 |
|
Vergriffen
Band 64
Susanne Marten-Finnis, Michael Nagel
Die PRESSA, Internationale Presseausstellung in Köln 1928, und der jüdische Beitrag
zum modernen Journalismus. The PRESSA, International Press Exhibition in Cologne 1928, and the Jewish
Contribution to Modern Journalism. Bd. 1
|
Vergriffen
Band 65
Susanne Marten-Finnis, Michael Nagel
Die PRESSA, Internationale Presseausstellung in Köln 1928, und der jüdische Beitrag
zum modernen Journalismus. The PRESSA, International Press Exhibition in Cologne 1928, and the Jewish
Contribution to Modern Journalism. Bd. 2
|
Band 66
Jochen Krenz
Konturen einer oberdeutschen kirchlichen Kommunikationslandschaft des ausgehenden 18.
Jahrhunderts
|
 |
 |
 |
|
Band 67
Klaus-Dieter Herbst (Hg.)
Astronomie, Literatur, Volksaufklärung. Der Schreibkalender der Frühen Neuzeit mit
seinen Text- und Bildbeigaben
|
Band 68
Reinhart Siegert (Hg.)
Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert Voraussetzungen – Medien –
Topographie
|
Band 69
Cornelia Bogen
Der aufgeklärte Patient. Strukturen und Probleme der Gesundheitskommunikation in der
Buch- und Zeitschriftenkultur des 17. und 18. Jahrhunderts
|
 |
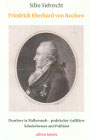 |
 |
|
Band 70
Ulrike Kruse:
Der Natur-Diskurs in Hausväterliteratur und volksaufklärerischen Schriften vom späten
16. bis zum frühen 19. Jahrhundert
|
Band 71
Silke Siebrecht:
Der Halberstädter Domherr Friedrich Eberhard von Rochow -- Handlungsräume und
Wechselbeziehungen eines Philanthropen und Volksaufklärers in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
|
Band 72
Rudolf Stöber:
Neue Medien. Geschichte: Von Gutenberg bis Apple und Google. Medieninnovation und
Evolution
|
 |
 |
 |
|
Band 73
Michael Nagel, Moshe Zimmermann (Hg.):
Judenfeindschaft und Antisemitismus in der deutschen Presse über fünf Jahrhunderte.
Erscheinungsformen, Rezeption, Debatte und Gegenwehr (Band 1)
|
Band 74
Michael Nagel, Moshe Zimmermann (Hg.):
Judenfeindschaft und Antisemitismus in der deutschen Presse über fünf Jahrhunderte.
Erscheinungsformen, Rezeption, Debatte und Gegenwehr (Band 2)
|
Band 75
Holger Böning:
300 Jahre Friedrich II. Ein Literaturbericht zum Jubiläumsjahr 2012. Eingeschlossen
einige Gedanken zum Verhältnis des großen Königs zu seinen kleinen Untertanen, zu Volksaufklärung und
Volkstäuschung sowie zur Publizistik
|
 |
 |
 |
|
Band 76
Holger Böning, Aïssatou Bouba, Esther-Beate Körber, Michael Nagel, Stephanie Seul (Hg.):
Deutsche Presseforschung. Geschichte und Forschungsprojekte des ältesten historischen
Instituts der Universität Bremen
|
Band 77
Ulrich Tadday (Hg.):
Musik und musikalische Öffentlichkeit. Musikbeilagen in Zeitungen, Zeitschriften und
Almanachen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
|
Band 78
Holger Böning:
Der Musiker und Komponist Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Studie zu den
Anfängen der Moralischen Wochenschriften und der deutschen Musikpublizistik. Zweite vollständig
durchgesehene und stark erweiterte Auflage zum 250. Todestag Johann Matthesons.
|
 |
 |
 |
|
Band 79
Marcus Sonntag:
Die Popularisierung der Inokulation und Vakzination. Impfkampagne im 18. und frühen
19. Jahrhundert.
|
Band 80
Holger Böning:
Zur Musik geboren. Johann Mattheson. Sänger an der Hamburger Oper, Komponist, Kantor
und Musikpublizist. Eine Biographie.
|
Band 81
Claire Gantet und Flemming Schock (Hg.):
Zeitschriften, Journalismus und gelehrte Kommunikation im 18. Jahrhundert. Festschrift
für Thomas Habel
|
 |
 |
 |
|
Band 82
Irmtraud Ubbens (Hg.):
Aus den Berliner Gerichten - 1928 bis 1933. Moritz Goldsteins Gerichtsfeuilletons in
der Vossischen Zeitung
|
Band 83
Ursula Prause (Hg.):
Werner Helwig. Eine nachgetragene Autobiographie
|
Band 84
Björn Vahldiek:
Propaganda und Unterhaltung. Wandel und Kontinuität in der Kriegsberichterstattung der
Familienzeitschrift ,Die Gartenlaube' (1853-1944)
|
 |
 |
 |
|
Band 85
Holger Böning, Michael Nagel:
Erster Weltkrieg und Bremer Presse. Impressionen und Schlaglichter auf das
Kriegserleben in der Hansestadt
|
Band 86
Patrick Farges:
Bindestrich-Kanadier?. Sudetendeutsche Sozialdemokraten und deutsche Juden als
Exilanten in Kanada. Studie zu Akkulturationsprozessen nach 1933
|
Band 87
Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer (Hg.):
Deutsche Sprache und Kultur im Banat. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und
Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und
Identitäten
|
 |
 |
 |
|
Band 88
Małgorzata A. Maksymiak:
Mental Maps im Zionismus. Ost und West in Konzepten einer jüdischen Nation vor 1914
|
Band 89
Wolfgang Schütte:
Mentalität und Kunstprogrammatik. Studie zum journalistischen und erzählenden Werk
Paul Fechters
|
Band 90
Olaf Kistenmacher:
Arbeit und »jüdisches Kapital«. Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung
Die Rote Fahne während der Weimarer Republik
|
 |
 |
 |
|
Band 91
Holger Böning und Susanne Marten-Finnis (Hg.):
Aufklären, Mahnen und Erzählen. Studien zur deutsch-jüdischen Publizistik, zum Kampf
gegen den Antisemitismus und zur subversiven Kraft des Erzählens. Festschrift für Michael Nagel
|
Band 92
Esther-Beate Körber:
Messrelationen. Geschichte der deutsch- und lateinischsprachigen „messentlichen“
Periodika von 1588 bis 1805
|
Band 93
Esther-Beate Körber:
Messrelationen. Biobibliographie der deutsch- und lateinischsprachigen „messentlichen“
Periodika von 1588 bis 1805. Bd. I
|
 |
 |
 |
|
Band 94
Esther-Beate Körber:
Messrelationen. Biobibliographie der deutsch- und lateinischsprachigen „messentlichen“
Periodika von 1588 bis 1805. Bd. II
|
Band 95
Robert Beyer:
Mit deutschem Blick. Israelkritische Berichterstattung über den Nahostkonflikt in der
bundesrepublikanischen Qualitätspresse
|
Band 96
Michael Nagel (Hg.):
Bremen & seine Presse im Ersten Weltkrieg
|
 |
 |
 |
|
Band 97
Susanne Marten-Finnis, Malgorzata A. Maksymiak und Michael Nagel (Hg.):
Länder der Verheißung, Verpflanzte Nachbarschaften und Andere Räume: Migration und die
Kunst ihrer Darstellung, 1920–1950
|
Band 98
Kai Lohsträter:
Die Entzündung der Geister. Kommunikation, Medien und Gesellschaft in der Ruhrregion
im 18. Jahrhundert
|
Band 99
Joanna Kodzik und Włodzimierz Zientara (Hg.):
Hybride Identitäten in den preußisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung
|
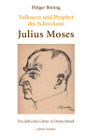 |
 |
 |
|
Band 100
Holger Böning:
Volksarzt und Prophet des Schreckens. Julius Moses. Ein jüdisches Leben in Deutschland
|
Band 101
Jochen Krenz:
Druckerschwärze statt Schwarzpulver. Wie die Gegenaufklärung die Katholische
Aufklärung nach 1789 mundtot machte
|
Band 102
Karin Cieslik, Helge Perplies und Florian Schmid (Hg.):
Materialität und Formation. Studien zum Buchdruck des 15. bis 17. Jahrhunderts.
Festschrift für Monika Unzeitig
|
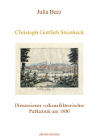 |
 |
 |
|
Band 103
Julia Beez:
Christoph Gottlieb Steinbeck. Dimensionen volksaufklärerischer Publizistik um 1800
|
Band 104
Dirk Sangmeister:
Vertrieben vom Feld der Literatur. Verbreitung und Unterdrückung der Werke von
Friedrich Christian Laukhard
|
Band 105
Elisabeth Böhm:
Epoche machen. Goethe und die Genese der Weimarer Klassik zwischen 1786 und 1796
|
 |
 |
 |
|
Band 106
Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer (Hg.):
Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien
|
Band 107
Jürgen Wilke:
Journalismus und Medien in Geschichte, Forschung und Praxis
|
Band 108
Bernd Klesmann, Patrick Schmidt und Christine Vogel (Hg.):
Jenseits der Haupt- und Staatsaktionen. Neue Perspektiven auf historische Periodika
|
 |
 |
 |
|
Band 109
Holger Böning (Hg.):
Volksaufklärung ohne Ende? Vom Fortwirken der Aufklärung im 19. Jahrhundert
|
Band 110
Holger Böning:
Justus Möser. Anwalt der praktischen Vernunft. Der Aufklärer, Publizist und
Intelligenzblattherausgeber
|
Band 111
Hauke Friederichs:
Piraten, Kaper und Korsaren im Mittelmeer
|
 |
 |
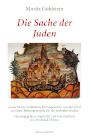 |
|
Band 112
Péter Urbán:
Wie das Blatt an der Baumkrone. Die deutschsprachige Presse in Bratislava (1919–1929)
|
Band 113
Jürgen Wilke:
Karl Jaspers und die Massenmedien. Der politische Philosoph im Widerstreit der
Öffentlichkeit
|
Band 114
Irmtraud Ubbens (Hg.):
Moritz Goldstein: Die Sache der Juden. sowie Moritz Goldsteins Korrespondenz aus dem
Exil zu einem Rettungsprojekt für die bedrohten Juden
|
 |
 |
 |
|
Band 115
Joanna Kodzik und Anna Mikołajewska (Hg.):
Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit.
Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara.
|
Band 116
Rudolf Stöber und Florian Paul Umscheid:
Politische Interessenkommunikation in der Modernisierung. Das Beispiel des
Regierungsbezirks Potsdam (1867–1914)
|
Band 117-120
Albrecht Hoppe, Klaus Neitmann, Rudolf Stöber (Hg.):
Die Immediatzeitungsberichte der Potsdamer Regierungspräsidenten 1867–1914. Eine
kommentierte Edition in 4 Bänden. Herausgegeben von Albrecht Hoppe, Klaus Neitmann, Rudolf Stöber.
Bearbeitet von Albrecht Hoppe
|
 |
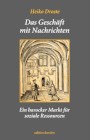 |
 |
|
Band 121
Irmtraud Ubbens:
1918/1919. Das alte Deutschland ist nicht mehr. Das Ende einer Epoche und das erste
Jahr der Republik im Feuilleton der Vossischen Zeitung
|
Band 122
Heiko Droste:
Das Geschäft mit Nachrichten. Ein barocker Markt für soziale Ressourcen
|
Band 123
Esther-Beate Körber:
Gelehrtenleben. Fiktive Biographien
|
 |
 |
 |
|
Band 124
Klaus-Dieter Herbst, Werner Greiling (Hg.):
Schreibkalender und ihre Autoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850)
|
Band 125
Esther-Beate Körber:
Musikgeschichten und andere fiktive Biographien
|
Band 126 Vergriffen
Holger Böning:
Dreißigjähriger Krieg und Öffentlichkeit. Zeitungsberichte als Rohfassung der
Geschichtsschreibung
Siehe Band 130
|
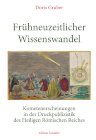 |
 |
 |
|
Band 127
Doris Gruber:
Frühneuzeitlicher Wissenswandel. Kometenerscheinungen in der Druckpublizistik des
Heiligen Römischen Reiches
|
Band 128
Holger Böning:
Geschichte der Hamburger und Altonaer Presse. Von den Anfängen bis zum Ende des Alten
Reichs. Band 1: Periodische Presse und der Weg zur Aufklärung
|
Band 129
Holger Böning:
Geschichte der Hamburger und Altonaer Presse. Von den Anfängen bis zum Ende des Alten
Reichs. Band 2: Periodische Presse, Kommunikation und Aufklärung
|
 |
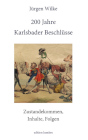 |
 |
|
Band 130
Holger Böning:
Dreißigjähriger Krieg und Öffentlichkeit. Zeitungsberichterstattung als Rohfassung der
Geschichtsschreibung. Zweite stark vermehrte Auflage.
|
Band 131
Jürgen Wilke:
200 Jahre Karlsbader Beschlüsse. Zustandekommen, Inhalte, Folgen
|
Band 132
Jörg Riecke und Tina Theobald (Hg.):
Deutschsprachige Zeitungen im östlichen Europa. Ein Katalog. Herausgegeben von Jörg
Riecke und Tina Theobald. Redigiert von Dominika Bopp
|
 |
 |
 |
|
Band 133
Dirk Sangmeister (Hg.):
Garlieb Merkel: Briefwechsel. Band I: Texte
|
Band 135
Joachim Behrend:
Inszenierungen Friedrichs des Großen. Die Historienbilder Robert Warthmüllers. Mit
einem Werkverzeichnis des Künstlers
|
Band 136
Johann August Ephraim Goeze:
Mit der Postkutsche durch die Mark Brandenburg nach Reckahn. Eine kleine
Reisebeschreibung zum Vergnügen der Jugend aus dem Jahr 1784
|
 |
 |
 |
|
Band 137
Hendrik Michael:
Die Sozialreportage als Genre der Massenpresse. Erzählen im Journalismus und die
Vermittlung städtischer Armut in Deutschland und den USA (1880–1910)
|
Band 138&139
Johannes Arndt, Esther-Beate Körber:
Periodische Presse in der Frühaufklärung (1700–1750). Ein Vergleich zwischen
Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Bd. I-II
|
Band 140
Holger Böning:
Der Noten und des Glückes Lauf. Georg Philipp Telemann. Ein poetischer Spaziergang
durch das Leben des Dichters und Publizisten
|
 |
 |
 |
|
Band 141
Holger Böning:
Für Glaubensfreiheit und gegen Absolutismus. Die Vorgeschichte des Dreißigjährigen
Kriegs im Jahrgang 1609 der beiden ersten gedruckten periodischen Zeitungen der Welt. Ein Lesebuch
|
Band 142
Reinhart Siegert:
Studien zum Zeitalter der Aufklärung im deutschsprachigen Raum 1750–1850. Band I:
Gesammelte Studien zur Volksaufklärung
|
Band 143
Reinhart Siegert:
Studien zum Zeitalter der Aufklärung im deutschsprachigen Raum 1750–1850. Band II:
Gesammelte Studien zum Literarischen Leben der Goethezeit, zur Sozialgeschichte der Literatur, zu den
Konfessionskulturen, zur Alphabetisierung und zur Nationalbibliographie der deutschsprachigen Länder
|
 |
 |
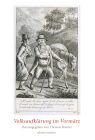 |
|
Band 144
Reinhart Siegert:
Studien zum Zeitalter der Aufklärung im deutschsprachigen Raum 1750–1850. Band III:
Aufklärung und Volkslektüre
|
Band 146
Holger Böning und Esther-Beate Körber (Hg.):
Johann Mattheson. Behauptung der himmlischen Musik aus den Gründen der Vernunft,
Kirchen-Lehre und heiligen Schrift. Im Neusatz herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort
versehen von Holger Böning und Esther-Beate Körber
|
Band 147
Thomas Bremer (Hg.):
Volksaufklärung im Vormärz
|
 |
 |
 |
|
Band 148
Daniel Bellingradt und Claudia Heise:
Eine Stadttour durch Hamburg im Jahr 1686. Die App Hidden Hamburg als erlebbare
Geschichte und Digital-Public-History-Experiment
|
Band 149
Susanne Marten-Finnis, Michael Nagel (Hg.):
Die historische deutsch-jüdische Presse. Forum, Sprachrohr, Quellenfundus
|
Band 150
Heinrich Zschokke:
Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizerbote erzählt. Ein Geschenk der
Heinrich-Zschokke-Gesellschaft zum 250. Geburtstag ihres Namengebers. Herausgegeben, ausgewählt,
kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Holger Böning
|
 |
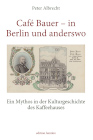 |
 |
|
Band 151
Holger Böning, Iwan-Michelangelo D’Aprile,Hanno Schmitt und Reinhart Siegert (Hg.):
Wer waren die Aufklärer?. Zum sozio-biographischen Hintergrund von „hoher“ Aufklärung
und Volksaufklärung
|
Band 152
Peter Albrecht:
Café Bauer – in Berlin und anderswo. Ein Mythos in der Kulturgeschichte des
Kaffeehauses
|
Band 153
Jürgen Wilke:
Erlebtes und Erforschtes. Erinnerungen
|
 |
 |
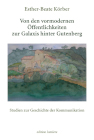
|
|
Band 154
Jürgen Wilke:
Medien, Journalismus und Medienforschung im Wandel. Gesammelte Studie IV
|
Band 155
Lothar Jordan:
Pressefreiheit. Studie zur Geschichte von Wort und Begriff
|
Band 156
Esther-Beate Körber:
Von den vormodernen Öffentlichkeiten zur Galaxis hinter Gutenberg. Studien zur
Geschichte der Kommunikation
|
 |
 |
 |
|
Band 157
Rudolf Stöber:
Deutschland-Bilder. Spiegelungen nationaler Identität
|
Band 159
Wolfgang Fink & Norbert Waszek (Hg./ed.):
Aufklärung und Vormärz – Kontinuitäten und Brüche // Des Lumières allemandes à 1848 –
continuité et ruptures
|
Band 160
Holger Böning:
Das Intelligenzblatt. Gemeinnutz und Aufklärung für jedermann.
Band I:
Entstehung und Entwicklung einer neuen publizistischen Gattung
|
 |
 |
 |
|
Band 161
Holger Böning:
Das Intelligenzblatt. Gemeinnutz und Aufklärung für jedermann.
Band II:
Inhaltliche Vielfalt und reichsweite Intelligenzblätter
|
Band 162
Holger Böning:
Bürger ohne Land. Johann Michael Afsprung. Deutscher Aufklärer und helvetischer
Revolutionär
|
Band 163
Esther-Beate Körber:
Grund der Wahrheit. Argumentations- und Plausibilitätsstrukturen in Flugschriften des
späteren 16. Jahrhunderts
|
 |
 |
|
Band 164
Daniel Bellingradt und Claudia Heise:
Eine Stadttour durch Hamburg im Jahr 1686. Die App Hidden Hamburg als
erlebbare Geschichte und Digital-Public-History-Experiment (2. Auflage)
|
Band 165
Holger Böning:
Christian Friedrich Daniel Schubart. Journalist und Kritiker des Journalismus,
Intelligenzblattredakteur und Publizist des Sturm und Drang
|
Exil - Forschungen und Texte
Herausgegeben von Hélène Roussel
Das deutschsprachige Exil ist nicht auf die Zeit von 1933 bis 1945 beschränkt. Es hat eine lange Tradition, die
nicht erst mit der Weimarer Republik beginnt und mit der Gründung der beiden deutschen Staaten in der
Nachkriegszeit noch längst nicht endet.
Ziel dieser Reihe ist es, Leistungen und Erfahrungen der Exilantinnen und Exilanten als Teil der
Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts – nicht nur Deutschlands und Österreichs, sondern auch der Gastländer –
dem heutigen Lesepublikum bewußt zu machen und in die Langzeitgeschichte wieder einzufügen. Angesichts der
Bedeutung von Kulturtransfers und Migrationen in den Globalisierungsprozessen zu Beginn des dritten Jahrtausends
ist insbesondere das exilbedingte Erleben der Koexistenz unterschiedlicher Kulturen und der Interkulturalität
von aktueller Bedeutung.
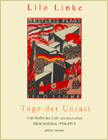 |
 |
|
|
Band 1 Vergriffen
Lilo Linke
Tage der Unrast. Von Berlin ins Exil: ein deutsches Mädchenleben 1914-1933. Mit einem
Nachwort und herausgegeben von Karl Holl. Aus der englischen Sprache von Dorothea Hasbargen-Wilke.
|
Band 2
Patrick Farges:
Bindestrich-Kanadier?. Sudetendeutsche Sozialdemokraten und deutsche Juden als
Exilanten in Kanada. Studie zu Akkulturationsprozessen nach 1933
|
|
Die jüdische Presse – Kommunikationsgeschichte im europäischen Raum
Herausgegeben von Susanne Marten-Finnis und Michael Nagel
Die historische deutsch-jüdische und europäisch-jüdische Presse gewinnt in der aktuellen Forschung zunehmend an
Bedeutung. Innerhalb der jüdischen Geschichte, vor allem in der Ausprägung und Diskussion einer jeweils
zeitbezogenen jüdischen Identität, spielt sie eine wichtige Rolle. Detailreich und differenziert forcieren und
dokumentieren die historischen jüdischen Zeitungen und Zeitschriften, Kalender, Almanache, Jahrbücher etc. seit
der Haskala eine teils innerjüdische, teils in die Allgemeinheit zielende Auseinandersetzung um politische,
gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse, Ziele und Vorstellungen, um Abwehr und Selbstbehauptung gegenüber
Judenfeindschaft und Antisemitismus. Umgekehrt erschließt sich diese Presse aus dem Kontext der
europäisch-jüdischen Geschichte, die soziale, politische wie kulturelle Aspekte beinhaltet und einen integralen
Bestandteil der allgemeinen Geschichte darstellt. Die interdisziplinär angelegte zweisprachige Reihe bringt
neuere Beiträge zur Erforschung der europäisch-jüdischen Presse seit der Aufklärung.
Die Bände der Reihe erscheinen zugleich in der Reihe "Presse und Geschichte - Neue Beiträge" und können auch
separat bezogen werden.
The European Jewish Press – Studies in History and Language
The academic discussion of recent years has embraced the cultural history of European Jewry including the
burgeoning of the Jewish press in the modern period. Jewish newspapers and journals, calendars, almanacs, and
annuals have been gaining increasing attention from scholars of various disciplines. The reasons are twofold:
firstly, the availability of source material, and the application of new media for electronic data storage and
retrieval; secondly the opening out of textual studies to the study of context, for meanings are created by
context. The perspectives of history and language are just two of many approaches applied today to investigate
the Jewish press: history, because of the way that press mirrored Jewish life in Europe; language, because of
the specific role the press adopted in generating and shaping Jewish consciousness. There are two aspects to the
latter approach, namely the active part that text has always played in the construction of Jewish identities,
and the use of different languages in the press as another revealing characteristic of this multilingual field
of production. In a more universal sense, the Jewish press is a legacy for studying the widest sphere of Jewish
cultural activity, and for examining the reactions to the crises and opportunities of modernity reflected in it;
not least, the press can offer relevant insights into the rise of European anti-Semitism. The current bilingual
series has undertaken to accommodate recent approaches to the study of the modern Jewish press and to keep
scholars abreast with ongoing developments in this field of research.
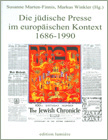
|
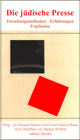 |
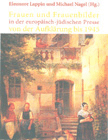 |
|
Band 1
Susanne Marten-Finnis und Markus Winkler
Die jüdische Presse im europäischen Kontext 1686-1990.
|
Band 2
Susanne Marten-Finnis und Markus Bauer
Die jüdische Presse – Forschungsmethoden – Erfahrungen – Ergebnisse.
|
Band 3
Eleonore Lappin und Michael Nagel
Frauen und Frauenbilder in der europäisch-jüdischen Presse von der Aufklärung bis
1945.
|
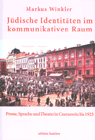 |
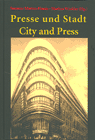 |
 |
|
Band 4
Markus Winkler
Jüdische Identitäten im kommunikativen Raum. Presse, Sprache und Theater in Czernowitz
bis 1923.
|
Band 5
Susanne Marten-Finnis und Markus Winkler
Presse und Stadt. City and Press.
|
Band 6
Eleonore Lappin und Michael Nagel
Deutsch–jüdische Presse und jüdische Geschichte: Dokumente, Darstellungen,
Wechselbeziehungen. Band 1
|
 |
 |
 |
|
Band 7
Eleonore Lappin und Michael Nagel
Deutsch–jüdische Presse und jüdische Geschichte: Dokumente, Darstellungen,
Wechselbeziehungen. Band 2
|
Band 8
Irmtraud Ubbens
Sein Kampf für Recht, Freiheit und Anstand war notorisch. Moritz Goldstein – "Inquit"
|
Band 9
Liliana Ruth Feierstein
Von Schwelle zu Schwelle. Einblicke in den didaktisch-historischen Umgang mit dem
Anderen aus der Perspektive jüdischen Denkens.
|
 |
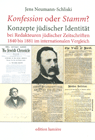 |
 |
|
Band 10
Julius Moses
Die Lösung der Judenfrage: Eine Rundfrage von Julius Moses im Jahre 1907
|
Band 11
Jens Neumann-Schliski
"Konfession" oder "Stamm"?. Konzepte jüdischer Identität bei Redakteuren jüdischer
Zeitschriften 1840 bis 1881 im internationalen Vergleich.
|
Band 12
Susanne Marten-Finnis, Michael Nagel
Die PRESSA, Internationale Presseausstellung in Köln 1928, und der jüdische Beitrag
zum modernen Journalismus. The PRESSA, International Press Exhibition in Cologne 1928, and the Jewish
Contribution to Modern Journalism. Bd. 1
|
 |
 |
 |
|
Band 13
Susanne Marten-Finnis, Michael Nagel
Die PRESSA, Internationale Presseausstellung in Köln 1928, und der jüdische Beitrag
zum modernen Journalismus. The PRESSA, International Press Exhibition in Cologne 1928, and the Jewish
Contribution to Modern Journalism. Bd. 2
|
Band 14
Michael Nagel, Moshe Zimmermann (Hg.):
Judenfeindschaft und Antisemitismus in der deutschen Presse über fünf Jahrhunderte.
Erscheinungsformen, Rezeption, Debatte und Gegenwehr (Band 1)
|
Band 15
Michael Nagel, Moshe Zimmermann (Hg.):
Judenfeindschaft und Antisemitismus in der deutschen Presse über fünf Jahrhunderte.
Erscheinungsformen, Rezeption, Debatte und Gegenwehr (Band 2)
|
 |
 |
 |
|
Band 16
Irmtraud Ubbens (Hg.):
Aus den Berliner Gerichten - 1928 bis 1933. Moritz Goldsteins Gerichtsfeuilletons in
der Vossischen Zeitung
|
Band 17
Patrick Farges:
Bindestrich-Kanadier?. Sudetendeutsche Sozialdemokraten und deutsche Juden als
Exilanten in Kanada. Studie zu Akkulturationsprozessen nach 1933
|
Band 18
Małgorzata A. Maksymiak:
Mental Maps im Zionismus. Ost und West in Konzepten einer jüdischen Nation vor 1914
|
 |
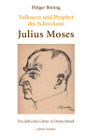 |
 |
|
Band 19
Olaf Kistenmacher:
Arbeit und »jüdisches Kapital«. Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung
Die Rote Fahne während der Weimarer Republik
|
Band 20
Holger Böning:
Volksarzt und Prophet des Schreckens. Julius Moses. Ein jüdisches Leben in Deutschland
|
Band 21
Holger Böning und Susanne Marten-Finnis (Hg.):
Aufklären, Mahnen und Erzählen. Studien zur deutsch-jüdischen Publizistik, zum Kampf
gegen den Antisemitismus und zur subversiven Kraft des Erzählens. Festschrift für Michael Nagel
|
 |
 |
 |
|
Band 22
Susanne Marten-Finnis, Malgorzata A. Maksymiak und Michael Nagel (Hg.):
Länder der Verheißung, Verpflanzte Nachbarschaften und Andere Räume: Migration und die
Kunst ihrer Darstellung, 1920–1950
|
Band 23
Jörg Riecke und Tina Theobald (Hg.):
Deutschsprachige Zeitungen im östlichen Europa. Ein Katalog. Herausgegeben von Jörg
Riecke und Tina Theobald. Redigiert von Dominika Bopp
|
Band 24
Susanne Marten-Finnis, Michael Nagel (Hg.):
Die historische deutsch-jüdische Presse. Forum, Sprachrohr, Quellenfundus
|
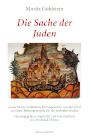 |
|
|
|
Band 25
Irmtraud Ubbens (Hg.):
Moritz Goldstein: Die Sache der Juden. sowie Moritz Goldsteins Korrespondenz aus dem
Exil zu einem Rettungsprojekt für die bedrohten Juden
|
|
|
Philanthropismus und populäre Aufklärung - Studien und Dokumente
Herausgegeben von Hanno Schmitt, Erhard Hirsch, Holger Böning gemeinsam mit Jens Brachmann, Rita Casale,
Christine Haug, Anke Lindemann, Jürgen Overhoff, Frank Tosch und Reinhart Siegert
Der Philanthropismus stellt im 18. Jahrhundert eine europaweit bedeutende Erziehungsbewegung und -lehre dar,
deren Bildungsprogramm auf praktische Lebensbewältigung ausgerichtet ist und ein gemeinnütziges und gleichwohl
individuell ausgefülltes Leben ermöglichen soll. Bildungsziele sind Menschen-liebe und umfassende religiöse
Toleranz.
Dem Gemeinwohl ist auch die Volksaufklärung verpflichtet, wie sich eine in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts zusammenfindende Bürgerinitiative selbst bezeichnet. Ihr Ziel ist die Popularisierung
aufklärerischen Denkens und Handelns beim "Volk", worunter diejenigen Teile der Bevölkerung ohne höhere Bildung
verstanden werden. Sie ist zunächst vorwiegend darum bemüht, die bäuerliche Bevölkerung zum Zwecke der Nutzung
in der Land-wirtschaft mit den neuen Erkenntnissen aufklärerischer Naturerforschung bekannt zu machen. Seit den
siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts wandelt sich die Volksaufklärung, indem sie ihr auf die wirtschaftliche
Aufklärung begrenztes Konzept aufgibt und nun um sittlich-moralische, religiöse und politische Aufklärung bemüht
ist.
Philanthropismus und Volksaufklärung haben programmatisch und personell zahlreiche Berührungspunkte, nicht
zuletzt in den starken Anstrengungen zur Verbesserung des Elementarschulwesens. Hier ist in ersten Ansätzen die
Formulierung eines gleichen Rechtes aller Bürger und auf politische Teilhabe zu verfolgen.
 |
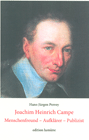 |
 |
|
Band 1
Hanno Schmitt, Holger Böning, Werner Greiling und
Reinhart Siegert
Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der
Aufklärung.
|
Band 2
Hans-Jürgen Perrey
Joachim Heinrich Campe (1746 – 1818). Menschenfreund – Aufklärer – Publizist.
|
Band 3
Reinhart Siegert (Hg)
Volksaufklärung. Ausgewählte Schriften. Ueber das Lesen der ökonomischen Schriften und
andere Texte vom Höhepunkt der Volksaufklärung (1781–1800).
|
 |
 |
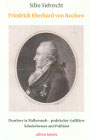 |
|
Band 4
Joachim Scholz
Die Lehrer leuchten wie die hellen Sterne. Landschulreform und Elementarlehrerbildung
in Brandenburg-Preußen. Zugleich eine Studie zum Fortwirken von Philanthropismus und Volksaufklärung in
der Lehrerschaft im 19. Jahrhundert.
|
Band 5
Reinhart Siegert (Hg.)
Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert Voraussetzungen – Medien –
Topographie
|
Band 6
Silke Siebrecht
Der Halberstädter Domherr Friedrich Eberhard von Rochow -- Handlungsräume und
Wechselbeziehungen eines Philanthropen und Volksaufklärers in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
|
 |
 |
 |
|
Band 7
Johanna Goldbeck
Volksaufklärerische Schulreform auf dem Lande in ihren Verflechtungen
|
Band 8
Marcus Sonntag:
Die Popularisierung der Inokulation und Vakzination. Impfkampagne im 18. und frühen
19. Jahrhundert.
|
Band 9
Hanno Schmitt und Holger Böning (Hg.):
Dessau-Wörlitz und Reckahn. Treffpunkte für Aufklärung, Volksaufklärung und
Philanthropismus
|
 |
 |
 |
|
Band 10
Holger Böning, Iwan-Michelangelo D’Aprile, Hanno Schmitt und Reinhart Siegert (Hg.)
Selbstlesen – Selbstdenken – Selbstschreiben. Prozesse der Selbstbildung von
„Autodidakten“ unter dem Einfluss von Aufklärung und Volksaufklärung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert
|
Band 11
Rudolph Zacharias Becker:
Noth- und Hülfsbüchlein (Band 1). Seitengleicher Antiqua-Neudruck der zweibändigen
Erstausgabe von 1788/1798
|
Band 12
Rudolph Zacharias Becker:
Noth- und Hülfsbüchlein (Band 2). Seitengleicher Antiqua-Neudruck der zweibändigen
Erstausgabe von 1788/1798
|
 |
 |
 |
|
Band 13
Rudolph Zacharias Becker:
Mildheimisches Lieder-Buch von 518 lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge
in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man besingen kann
|
Band 14
Holger Böning (Hg.):
Volksaufklärung ohne Ende? Vom Fortwirken der Aufklärung im 19. Jahrhundert
|
Band 15
Sonja Brandt-Michael:
Standeserziehung & Elitebildung im Adel des 18. Jahrhunderts. Die Briefe des jungen
Staatsministers Ernst Friedrich Herbert von Münster an seine Mutter
|
 |
 |
 |
|
Band 16
Dirk Sangmeister (Hg.):
Garlieb Merkel: Briefwechsel. Band I: Texte
|
Band 18
Johann August Ephraim Goeze:
Mit der Postkutsche durch die Mark Brandenburg nach Reckahn. Eine kleine
Reisebeschreibung zum Vergnügen der Jugend aus dem Jahr 1784
|
Band 19
Reinhart Siegert:
Studien zum Zeitalter der Aufklärung im deutschsprachigen Raum 1750–1850. Band I:
Gesammelte Studien zur Volksaufklärung
|
 |
 |
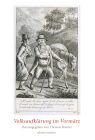 |
|
Band 20
Reinhart Siegert:
Studien zum Zeitalter der Aufklärung im deutschsprachigen Raum 1750–1850. Band II:
Gesammelte Studien zum Literarischen Leben der Goethezeit, zur Sozialgeschichte der Literatur, zu den
Konfessionskulturen, zur Alphabetisierung und zur Nationalbibliographie der deutschsprachigen Länder
|
Band 21
Reinhart Siegert:
Studien zum Zeitalter der Aufklärung im deutschsprachigen Raum 1750–1850. Band III:
Aufklärung und Volkslektüre
|
Band 22
Thomas Bremer (Hg.):
Volksaufklärung im Vormärz
|
 |
 |
|
|
Band 23
Holger Böning, Iwan-Michelangelo D’Aprile,Hanno Schmitt und Reinhart Siegert (Hg.):
Wer waren die Aufklärer?. Zum sozio-biographischen Hintergrund von „hoher“ Aufklärung
und Volksaufklärung
|
Band 24
Jürgen Overhoff / Joachim Scholz (Hrsg.):
Aufklärung und Anthropozän. Neue Verhältnisbestimmungen von Mensch und Natur im
Zeichen der anthropologischen Wende
|
|
Volksaufklärung. Ausgewählte Schriften.
Herausgegeben seit 1992 von Holger Böning und Reinhart Siegert.
Lieferbar beim Verlag frommann-holzboog sind 10 Bände. In der edition lumière erscheinen die Bände 9, 10 und 12
 |
 |
 |
|
Band 9.1
Rudolph Zacharias Becker:
Noth- und Hülfsbüchlein (Band 1). Seitengleicher Antiqua-Neudruck der zweibändigen
Erstausgabe von 1788/1798
|
Band 9.2
Rudolph Zacharias Becker:
Noth- und Hülfsbüchlein (Band 2). Seitengleicher Antiqua-Neudruck der zweibändigen
Erstausgabe von 1788/1798
|
Band 10
Rudolph Zacharias Becker:
Mildheimisches Lieder-Buch von 518 lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge
in der Welt und alle Umstände des menschlichen Lebens, die man besingen kann
|
 |
|
|
|
Band 12
Reinhart Siegert (Hg)
Volksaufklärung. Ausgewählte Schriften. Ueber das Lesen der ökonomischen Schriften und
andere Texte vom Höhepunkt der Volksaufklärung (1781–1800).
|
|
|
Weitere Publikationen der edition lumière
 |
 |
 |
|
Heinrich Zschokke
Weiß wie der Teufel.
Erzählungen von Heinrich Zschokke.
2. durchgesehene, überarbeitete und erweiterte Auflage.
|
Hans Wolf Jäger
Vergnügen und Engagement
|
Vergriffen
Hans Wolf Jäger,
Holger Böning,
Gert Sautermeister
Genußmittel und Literatur
|
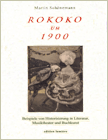 |
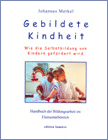 |
 |
|
Martin Schönemann
ROKOKO um 1900 Beispiele
von Historisierung in Literatur, Musiktheater und
Buchkunst
|
Johannes Merkel
Gebildete Kindheit. Wie die Selbstbildung von Kindern gefördert wird. Handbuch der
Bildungsarbeit im Elementarbereich.
|
Christiane Solte-Gresser, Wolfgang Emmerich und Hans Wolf Jäger
Eros und Literatur. Liebe in Texten von der Antike bis zum Cyberspace.
|
 |
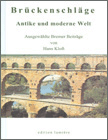 |
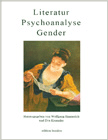 |
|
Horst Gnettner
Der Bremer Afrikaforscher Gerhard Rohlfs. Vom Aussteiger zum Generalkonsul. Eine
Biographie
|
Hans Kloft
Brückenschläge. Ausgewählte Bremer Beiträge.
|
Wolfgang Emmerich und Eva Kammler
Literatur Psychoanalyse Gender. Vergriffen
|
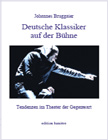 |
 |
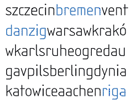 |
|
Johannes Bruggaier
Deutsche Klassiker auf der Bühne. Tendenzen im Theater der Gegenwart.
|
Johannes Merkel
Sprache der inneren Welt. Spielen – Erzählen – Phantasieren
|
Inge Buck, Birgid Hanke und Wolfgang Schlott
Städtebilder.
Bremen – Danzig – Riga
|
 |
 |
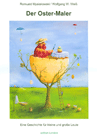 |
|
Monika Unzeitig
Grenzen überschreiten – transitorische Identitäten: Beiträge zu Phänomenen räumlicher,
kultureller und ästhetischer Grenzüberschreitung in Texten vom Mittelalter bis zur Moderne
|
Hans Wolf Jäger,
Holger Böning,
Gert Sautermeister
Genußmittel und Literatur
Durchgesehene und um fünf
Beiträge erweiterte Auflage.
|
Romuald Mysiakowski / Wolfgang W. Weiß
Der Oster-Maler
Eine Geschichte für kleine und große Leute.
|
 |
 |
 |
|
Tilman Hannemann
Bremer Religionsgeschichten. Kontinuitäten und Wandel zwischen Religion und
Gesellschaft
|
Heinrich Zschokke
Das Goldmacherdorf. Eine anmuthige und wahrhafte Geschichte vom aufrichtigen und
wohlerfahrenen Schweizerboten
|
Leif Kramp, Nico Carpentier, Andreas Hepp, Ilija Tomanic' Trivundža, Hannu Nieminen,
Risto Kunelius, Tobias Olsson, Ebba Sundin und Richard Kilborn
Media Practice and Everyday Agency in Europe
|
 |
 |
 |
|
Leif Kramp, Nico Carpentier, Andreas Hepp, Ilija Tomanić Trivundža, Hannu Nieminen, Risto
Kunelius, Tobias Olsson, Ebba Sundin and Richard Kilborn (Ed.)
Journalism, representation and the public sphere
|
Frank Tosch
Heinrich Julius Bruns (1746–1794). Schüler – Lehrer – Lehrerbildner
|
Leif Kramp, Nico Carpentier, Andreas Hepp, Richard Kilborn, Risto Kunelius, Hannu
Nieminen, Tobias Olsson, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Ilija Tomanić Trivundža and Simone Tosoni (Ed.)
Politics, Civil Society and Participation
|
 |
 |
 |
|
Franz Josef Degenhardt
Deutsche Lieder – German Songs
|
Karl Holl und Hans Kloft (Hg.)
Elbe, Rhein und Delaware. Flüsse und Flussübergänge als Orte der Erinnerung
|
Simone Tosoni et al (Hg.)
Present Scenarios of Media Production and Engagement
|
 |
 |
 |
|
Claudia Horst und Tassilo Schmitt (Hg.)
Die antike Stadt
|
Laura Peja et al (Ed.)
Current Perspectives on communication and media research
|
Maria Francesca Murru et al (Ed.):
Communication as the Intersection of the Old an the New. The Intellectual Work of the
2018 European Media and Communication Doctoral Summer School
|
»Großbothener Vorträge«
Herausgegeben von Bernhard Debatin und Arnulf Kutsch, ab Band 3 von Arnulf Kutsch und Stefanie Averbeck.
Die Großbothener Vorträge erscheinen jährlich und bieten Beiträge in- und ausländischer Wissenschaftler zur
Kommunikations- und Medienwissenschaft.
 |
 |
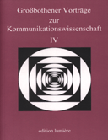 |
|
Bernhard Debatin,
Arnulf Kutsch
Großbothener Vorträge II
|
Bernhard Debatin,
Arnulf Kutsch
Großbothener Vorträge III
|
Stefanie Averbeck,
Klaus Beck,
Arnulf Kutsch
Großbothener Vorträge IV
|
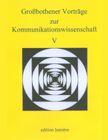 |
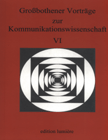 |
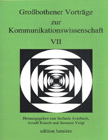 |
|
Arnulf Kutsch und
Stefanie Averbeck
Großbothener Vorträge V
|
Stefanie Averbeck,
Arnulf Kutsch und
Susanne Voigt
Großbothener Vorträge VI
|
Stefanie Averbeck,
Arnulf Kutsch und
Susanne Voigt
Großbothener Vorträge VII
|
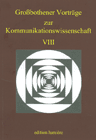 |
 |
 |
|
Stefanie Averbeck,
Arnulf Kutsch und
Susanne Voigt
Großbothener Vorträge VIII
|
Arnulf Kutsch und
Johannes Raabe
Großbothener Vorträge IX
|
Arnulf Kutsch,
Johannes Raabe und
Denise Sommer
Großbothener Vorträge X
|
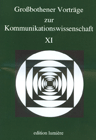 |
 |
 |
|
Stefan Jarolimek, Arnulf Kutsch und Denise Sommer
Großbothener Vorträge XI
|
Jasper A. Friedrich, Arnulf Kutsch, Denise Sommer
Großbothener Vorträge XII
|
Stefan Jarolimek, Arnulf Kutsch, Denise Sommer
Großbothener Vorträge XIII
|
 |
|
|
|
Stefan Jarolimek, Arnulf Kutsch und Denise Sommer
Großbothener Vorträge XIV
|
|
|
Pressburger Akzente: Vorträge zur Kultur- und Mediengeschichte
Eine Schriftenreihe des Instituts für Germanistik, Skandinavistik und Niederlandistik an der
Comenius-Universität Bratislava. Herausgegeben von Sabine Eickenrodt und Jozef Tancer
Unter dem Titel Pressburger Akzente wird mit dieser dritten Nummer eine neue Schriftenreihe an
der Comenius-Universität Bratislava fortgesetzt, die kultur- und mediengeschichtliche Forschungsbeiträge
präsentiert.
Dieses interdisziplinär orientierte Periodikum basiert auf kulturwissenschaftlichen Gastvorträgen aus der
Slowakei und deren angrenzenden Nachbarstaaten – sowie aus Deutschland. Alle hier abgedruckten Detailstudien
in deutscher Sprache gehen auf Vorträge am Institut für Germanistik, Niederlandistik und Skandinavistik
zurück. Sie setzen den Konsens darüber voraus, dass polyphone und hybride Sprachlandschaften einen
„Gedächtnisraum“ entwerfen: im Sinne einer Wahrnehmung von Landschaften und gesellschaftlichen Sprachräumen,
die als topographisch vermittelte kollektive Erinnerungsleistungen verstanden werden, als literarische,
kultur- und medienge-geschichtliche Konstruktionen und Fiktionalisierungen. Somit werden Fragen der Ästhetik
und Poetik auf kulturelle Phänomene übertragen und die semiotische Vermittlung von Wahrnehmungsräumen in den
Blick genommen.
Das Erkenntnisinteresse richtet sich insbesondere auf die sprachliche Realisierung von Landschaften, deren
kulturpoetische Bedeutung und metaphorische Repräsentation in Texten und weiteren Medien. Erwünscht sind
Beiträge, die sich kollektiv überlieferten und durch mediale Vermittlung imaginierten Landschaften widmen
(wie z. B. der des „blauen Donau-Raums“, der „wilden Karpaten“, der „ungarischen Steppe“, der „heiligen
Berge“, des „unbekannten Ostens“, des „deutschen Waldes“). Der Schwerpunkt dieses Periodikums liegt auf den
kulturhistorischen Topoi mehrsprachiger Kommunikation und den mit ihnen verbundenen Zuschreibungen von
„Landschaften“ und „Sprachlandschaften“. Legitimiert wird er durch das Wissen um die Multilingualität einer
Bevölkerung, die slowakische, tschechische, ungarische und deutsche Akzente setzte; sie ist mit der Geschichte
Bratislavas als eines bedeutenden medialen Ortes in Zentraleuropa eng verbunden.
Die bisher erschienenen Beiträge sind durch die edition lumière, Bremen, zum Preis von 9,50 Euro lieferbar:

|

|
 |
|
Anke Bennholdt-Thomsen
Pressburger Akzente 1: Donaustrom und Meer. Wasser-Landschaften als Erinnerungs-Orte
in Ingeborg Bachmanns Werk Nicht mehr lieferbar
|
Jozef Tancer
Pressburger Akzente 2: Der schwarze Sabbat. Die Brandkatastrophe in Pressburg 1913 als
Medienereignis Nicht mehr lieferbar
|
Erhard Schütz
Pressburger Akzente 3: „In den Wäldern selig verschollen“. Waldgänger in der deutschen
Literatur seit der Romantik
|
 |
 |
 |
|
Michael Bongardt
Vergriffen
Pressburger Akzente 4: Ein Weg ins Deutsche. Biographie, Dichtung und Glaube im Werk
des israelischen Autors Elazar Benyoëtz
|
Rüdiger Görner
Pressburger Akzente 5: Landschaft im (Alp-)Traum. Zu einem Motiv Georg Trakls im
erweiterten Umfeld
|
Roland Berbig
Pressburger Akzente 6: Landschaft und Ort bei Günter Eich und Ilse Aichinger
|
 |
 |
 |
|
Moritz Csáky
Pressburger Akzente 7: „Es gibt eine Überlieferung, die Katastrophe ist“. Die
Mehrfachcodierung von Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa
|
Clemens Ruthner:
Pressburger Akzente 8: Verzahnte Heimsuchungen. Eine kurze Literatur- und
Kulturgeschichte des Vampirs
|
Sabine Eickenrodt:
Pressburger Akzente 9: Terra incognita. Stifters Ungarn in der Erzählung
Brigitta
|
Hans-Wolf Jäger: Vorlesungen zur deutschen Literaturgeschichte
Herausgegeben von Holger Böning
Wenn in früheren Jahrhunderten Vorlesungen nötig gewesen sind, weil es keine gedruckten Literaturgeschichten
zu kaufen gab (Vorlesungsnachschriften wurden noch im 19. Jahrhundert teuer wie Silberbesteck oder
Tischwäsche gehandelt), so könnten Vorlesungen heute dringlich sein, weil es – dazu oft in Form von
Einzelstudien unterschiedlichster Verfasser – zu viele Literaturgeschichten gibt. Studierenden wie
Liebhabern der Literatur kann dabei die Orientierung schwerfallen. Hingegen sollte ihnen eine von einem Autor
ohne Fachjargon zusammenhängend erzählte, von einem Temperament getragene und durchaus pointierte
Darstellung wünschbar erscheinen. Zum literarischen Genuss wie zu Kritik und Gewinn eines eigenen
Standpunktes dürfte eine solche Lektüre leichter verlocken.
 |
 |
 |
|
Hans-Wolf Jäger
Band I: Humanismus, Reformation und Bauernkrieg
|
Hans-Wolf Jäger
Band II: Barock
|
Hans-Wolf Jäger
Band III: Aufklärung
|
 |
 |
 |
|
Hans-Wolf Jäger
Band IV: Empfindsamkeit. Sturm und Drang. Göttinger Hain
|
Hans-Wolf Jäger
Band V: Klassik
|
Hans-Wolf Jäger
Band VI: Romantik
|
 |
 |
 |
|
Hans-Wolf Jäger
Band VII: Biedermeier / Vormärz
|
Hans-Wolf Jäger
Band VIII: Realismus und Gründerzeit
|
Hans-Wolf Jäger
Band IX: Naturalismus / Literatur um 1900
|
 |
 |
|
Hans-Wolf Jäger
Band XI: Boheme / Expressionismus
|
Hans-Wolf Jäger
Band XI: Metrik
|
Literaturgeschichte und bildende Kunst
Von Guido Boulboulle
Mit dem Ergänzungsband zur Metrik sind alle elf Bände von Hans-Wolf Jägers Vorlesungen zur deutschen
Literaturgeschichte veröffentlicht.[1] Was mich als Kunsthistoriker an diesem Unternehmen besticht, ist –
abgesehen von der literarischen und wissenschaftlichen Leistung der einzelnen Vorlesungen - die ungewöhnliche
Gestaltung der Einbände mit elf Kunstwerken deutscher Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts, mit Ölbildern,
Aquarellen, Collagen. Während herkömmlicherweise eine bildlose seriöse Aufmachung den wissenschaftlichen
Anspruch einer Literaturgeschichte unterstreicht oder eine der Epoche entsprechende Bildauswahl – etwa Goethes
Bildnis für die Klassik- die einzelnen Themenbände ziert, sind es in diesem Falle elf abstrakte Werke, die der
Autor zusammen mit dem Herausgeber für die Titelbilder reproduziert haben. Dabei dürften die ausgewählten
Künstler dem Käufer, aber auch dem Kunsthistoriker in der Regel wohl eher fremd sein.
Obwohl die Einbände, sieht man sie in einer gleichmäßigen Reihung nebeneinander, miteinander korrespondieren
und somit die Einheitlichkeit des Unternehmens betonen, ist keines der Bilder eigens für die Bände geschaffen
worden. Für eine historische Übersicht über die deutsche Literatur vom 15. bis zum 20. Jahrhundert bleibt ihre
Wahl ungewöhnlich. Dass Hans-Reinhard Lehmphul (1938-2019) für Humanismus, Barock, Aufklärung, Empfindsamkeit
und Klassik ausgewählt wurde, Heiko Herrmann (geb. 1953) für Romantik und Vormärz, Herbert Kitzel (1928-1978)
für Realismus, Friedemann Hahn (geb. 1949) für Naturalismus und schließlich Jan Voss (geb. 1936) für
Expressionismus und den Ergänzungsband Metrik, erklärt sich kaum aus einer ungewöhnlichen Form der Werbung, die
den Käufer animieren soll. Selbst für eine unorthodoxe Interpretation geschichtlicher Rückblicke bleibt ihre
Zusammenstellung überraschend.
Was also hat den Verfasser bewogen, für seine Literaturgeschichte Werke dieser fünf Künstler auszusuchen?
Auffällig ist, dass alle fünf Künstler in etwa Zeitgenossen von Hans-Wolf Jäger (geb. 1936) sind und mit
Ausnahme von Herbert Kitzel ihre künstlerische Karriere in den 1960er und 1970er Jahren begannen, im selben
Zeitraum wie er seine Professur in Bremen. In allen Werken dominiert eine farblich ausgeprägte Abstraktion, auch
in dem Aquarell von Friedemann Hahn, das mit seinem Titel auf das südfranzösische L’Estaque verweist. Bis auf
eine Ausnahme, einem Ölbild Lehmphuls' im Besitz des Herausgebers, befinden sich alle Werke in Jägers privater
Kunstsammlung, in der seit den 1970er Jahren die zeitgenössische Kunst dominiert.
Für mich macht diese Auswahl deutlich, dass Jäger einen Einblick in seine persönlichen Kunstinteressen gewährt.
Er unterstreicht damit zugleich eine bestimmte Eigenart seiner Literaturgeschichte, ihren subjektiven Charakter.
Sie zeigt sich im geschriebenen Text in der Beibehaltung der Vorlesungsform, die für den Leser die unmittelbare
Hinwendung zum Zuhörer bewahrt. Sie zeigt sich zweitens in der gewählten Form der Darstellung, die nicht auf
Vollständigkeit rekurriert, sondern sich auf die wichtigen charakteristischen Züge der jeweiligen Epoche
konzentriert, so wie ein abstraktes Bild nicht in der Beschreibung der einzelnen Farb- und Bildelemente, sondern
in ihrem individuellen Zusammenklang verstehbar wird. Drittens wird sie für mich auch sichtbar an Jägers
auffälligem Interesse, durch umfangreiche Textauszüge und präzise Gedichtinterpretationen den Zuhörern die
sprachlichen und künstlerischen Eigenarten der jeweiligen Epoche zu vermitteln.
Die Zuhörer sollen sich mit den stilistischen Eigenarten der jeweiligen Epoche auseinandersetzen und sich auf
ihre jeweiligen künstlerischen Ambitionen einlassen, objektives Verständnis und individuelles Interesse
verbinden. Unterstützt wird diese Intention durch Bildbeispiele, die den Vorlesungstext begleiten. Zwei
einprägsame Beispiele möchte ich herausgreifen. Jäger erläutert an ausgewählten barocken Porträts im Vergleich
zu den voraufgegangenen humanistischen Brustbildnissen, wie sich künstlerische Ausdrucksweisen verändern und
augenfällig fassbar werden.[2] Mit ausführlichen Bildinterpretationen beschreibt er die neuartigen Themen und
veränderten gestalterischen Mittel, mit denen sich die Gründerzeit von der Epoche des Realismus abhebt,
überzeugt davon, "dass es in der bilden Kunst ähnlich zugehe wie in der Literatur"[3] und sich in beiden
Kunstformen die gleiche Spannweite zeige.[4]
Wenn sich Literatur und bildende Kunst im historischen Rückblick gegenseitig erhellen, wie verhält es sich dann
mit der Abbildung von Gegenwartsbildern, die fern jeder historischen Gleichzeitigkeit für eine
Literaturgeschichte werben? Stellen sie die chronologische Abfolge in Frage, an der sich eine Epochenübersicht
notwendig orientiert? Eine Chronologie der Kunststile, so nützlich auch ihre Kenntnis ist, bleibt stets eine
Konstruktion, wie auch das Nach- und Miteinander literarischer Ausdrucksformen sich nicht in eine eindeutig
fortschreitende Geschichtsentwicklung gliedern lässt. Bereits im ersten Band seiner Literaturgeschichte hat
Jäger eingangs auf diese Problematik hingewiesen. Dort heißt es:
„Sie bemerken, wie mit fortschreitender Einsicht in die Einzelheiten der Vergangenheit, wie mit vermehrten
Nachdenken die Begriffe fließend und Epochengrenzen wankend werden. Dieses kann aber erst dann geschehen, wenn
sie zunächst einmal gesetzt sind; erst danach sieht der forschende Blick Ähnlichkeiten, Vorläuferschaften,
frühere Ansätze. Zeitlich-epochale Grenzsetzungen aber sind nötig (…) für spätere Differenzierungen
(…).“[5]
Der Blick aus der Gegenwartsmalerei zurück in die literarische Vergangenheit verdeutlicht mir die
Widersprüchlichkeit einer Geschichte von Epochenabläufen. Er stärkt außerdem den subjektiven Blick von heute,
mit dem wir auf das Vergangene zurückblicken, es gliedern und zugleich versuchen, es für unsere eigene Gegenwart
zu erschließen. Die kritische Lektüre einer Literaturgeschichte bedarf des interessierten Lesers, der sich
reflektiert mit historischer Erinnerung auseinandersetzt. Mit Blick auf Bilder der Gegenwartskunst, die keinem
kanonischen Bildgedächtnis entsprechen, und mit der gleichzeitigen Wahrnehmung historischer Werke, die sich zu
einem literarischen Kanon zusammenschließen, stellt sich für mich die Frage, wie sich aus dem Heute ein
einsichtiges Verständnis der Vergangenheit erschließt.
Auf diese Problematik hat Jäger selbst eine Antwort gegeben. Sie findet sich in der Einleitung zum Barockband.
Der Mensch, so führt er aus, „soll sich Rechenschaft geben können über Geschichte und Vorgeschichte seiner
eigenen Lebenswelt.“[6] Und etwas später fährt er fort:
„Der Literaturhistoriker möchte die Literatur in ihrer geschichtlichen Entwicklung kennen lernen und mit
den literarischen Großvätern und geistigen Vorvätern auch die eigene Geschichte, unsere. Denn in der Literatur
sind die Wünsche und Glücksträume, die Leiden, Enttäuschungen und Selbsttäuschungen, die Gedanken einer Zeit
über sich selbst und die Wertvorstellungen einer Epoche aufbewahrt. Sie haben sich nicht in Luft aufgelöst,
sondern wirken weiter auf uns, in uns hinein.“[7]
Aber wie erkennen wir, was für uns bedeutsam ist? Was berührt uns noch, was lässt uns gleichgültig? Gegenwart
und Vergangenheit befinden sich in einem uneindeutigen Wechselspiel. Wir Heutigen sind es, die in den Spuren der
Vergangenheit Einsichten für unsere Gegenwart zu finden hoffen. Vielleicht bewusst, vielleicht nur ahnungsvoll
verweist die Gestaltung der Buchbände auf diesen widersprüchlichen Prozess der Selbsterkenntnis. Wir müssen
ergründen, was in der Vergangenheit für uns noch gegenwärtig ist und wie sich aus der Sicht des Vergangenen
unsere Gegenwart begreifen lässt. Nicht nur „erkennen (wir, G.B.) die Erbschaften, lesen überall die Traditionen
heraus“[8], wir begründen sie auch.
Bezüge zur Gegenwart oder Hinweise auf Wiederaufnahmen von Texten aus früheren Epochen finden sich verstreut in
den verschiedenen Bänden. So enthält der letzte Band, in dem die Epoche der Bohème um 1900 vorgestellt wird,
unerwartete Andeutungen zu späteren Gruppierungen der Bohème, den Beatniks und den Provos nach dem zweiten
Weltkrieg.[9] Einen weiteren Aspekt bilden Rückbezüge jüngerer Autoren auf ältere Dichtungen, z. B. auf die
Wiederaufnahme und Neugestaltung humanistischer Stoffe in der Klassik.[10] Bei aufmerksamer Lektüre stolpert man
immer wieder über ergänzende Bemerkungen etwa zu einzelnen Lebensläufen[11] oder zu ideologischen
Vereinnahmungen von Schriften[12], die politische Kontroversen der Vorlesungszeit aufscheinen lassen.
Bei aller Konzentration auf die jeweilige Epoche und ihre Wesensmerkmale bewahrt Jäger seiner historischen
Darstellung einen untergründigen Bezug zur Gegenwart, wie es bereits die Bilder auf den Buchdeckeln sichtbar
machen. Sein Interesse gilt nicht nur der Vermittlung historischer Kenntnisse, er möchte zugleich den Zuhörer
ermuntern, die eigene Leselust zu stärken und sich künstlerischen Neuentdeckungen zu öffnen. Die
Einbandgestaltung unterstützt diese Intention auf eigenwillige Weise, in dem sie den Leser mit unvertrauten
Kunstwerken konfrontiert. Diese können seine Neugierde auf die Epoche wecken, in der er die Literaturgeschichte
zur Hand nimmt, und auf Entdeckungen, die die Vergangenheit neu sehen lassen.
[1] Hans-Wolf Jäger: Vorlesungen zur deutschen Literaturgeschichte. 11 Bände, hrsg. von Holger Böning. Bremen:
edition lumière, 2015 - 2021
[2] Band II, S. 17 - S. 24.
[3] Band VIII, S. 214. Die Erläuterungen zur Malerei der Gründerzeit auf den Seiten 211 - 221.
[4] Ebenda, S.221
[5] Band I, S.20.
[6] Band II, S.8.
[7] Ebenda.
[8] Band X, S.328.
[9] Ebenda, S. 120ff.
[10] Vgl. Band I, S. 347ff.
[11] Z.B. in Band X bei den Expressionisten
[12] Z.B. in Band IV, S.221 (Physiognomik) oder in Band X, S. 18f. und S. 123f. (Schwabinger Kosmiker)